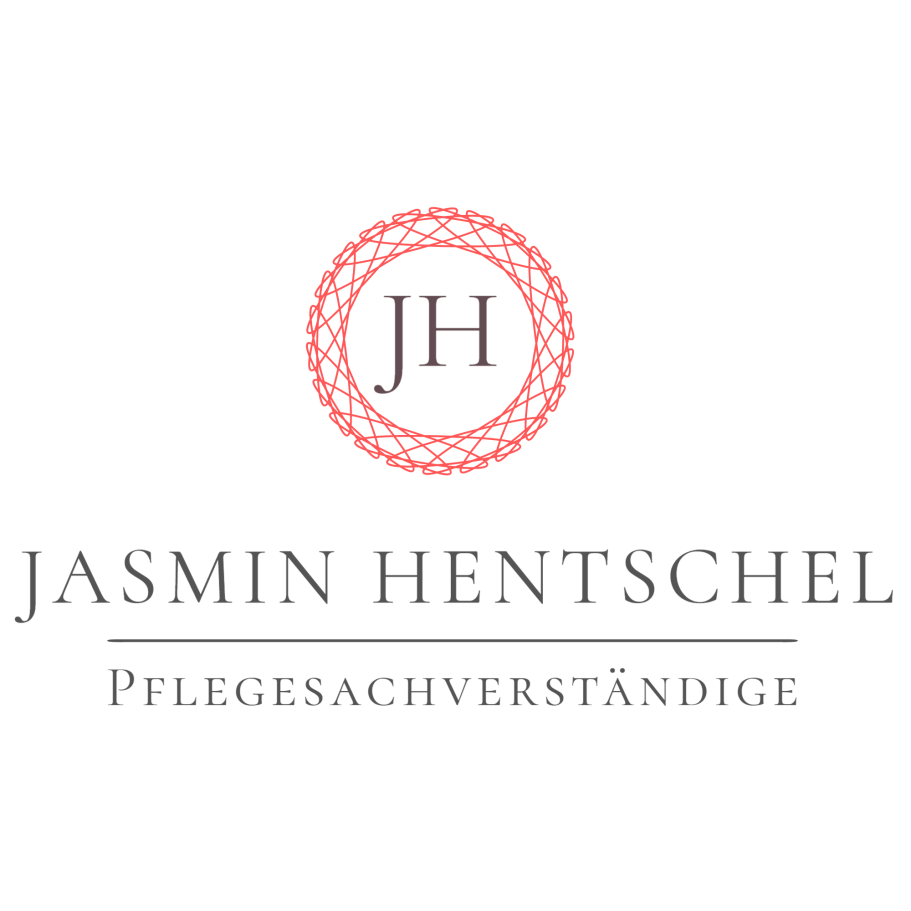Gut zu wissen!

Wer ist pflegebedürftig?
Pflegebedürftig sind nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§14 SGB XI) Menschen, deren Selbstständigkeit und Fähigkeiten in bestimmten Kriterien aufgrund körperlicher, kognitiver oder psychischer Beeinträchtigungen derart eingeschränkt sind, dass diese nicht mehr ohne fremde Hilfe kompensiert werden können. Diese Beeinträchtigungen müssen dabei voraussichtlich für mindestens sechs Monate und, nach § 15 SGB XI, in einer gewissen Schwere vorliegen. Die relevanten Kriterien, sind im nächsten Abschnitt beschrieben.
Was viele nicht wissen: auch Kinder und Jugendliche können pflegebedürftig sein und ihnen stehen demnach auch die entsprechenden Leistungen, wie zum Beispiel das Pflegegeld, zu.
Ob tatsächlich eine Pflegebedürftigkeit vorliegt, entscheidet die Pflegekasse. Als Entscheidungshilfe liegt hierbei ein Pflegegutachten zugrunde, welches, nach einem Hausbesuch beim Versicherten, von dem Pflegegutachter des Medizinischen Dienstes oder MEDICPROOF erstellt wurde.

Wie wird der Pflegegrad ermittelt?
Anhand der Begutachtungsrichtlinie beurteilen die Pflegegutachter im persönlichen Gespräch mit den Versicherten, ob und inwieweit sie pflegebedürftig, im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, sind.
Bei einer Pflegebegutachtung werden insgesamt 8 relevante Kriterien, sogenannte Module des persönlichen Lebensbereiches bewertet. Entscheidend hierbei ist, ob bestimmte Tätigkeiten selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig oder unselbstständig durchgeführt werden können oder wie häufig Hilfestellungen erforderlich sind.
Modul 1: Mobilität
Im Bereich der Mobilität wird u.a. geprüft, ob sich die betreffende Person selbst im Wohnumfeld fortbewegen, Treppensteigen oder sich nachts im Bett alleine drehen kann.
Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
In diesem Modul wird die räumliche und zeitliche Orientierungsfähigkeit der betreffenden Person ermittelt. Vor allem die Fähigkeit, ob Risikosituationen adäquat erkannt werden können, spielen eine große Rolle sowie, ob betreffende Person Informationen verstehen und darauf angemessen reagieren können. Ein wichtiger Faktor ist auch die Fähigkeiten sich an Gesprächen beteiligen zu können.
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
Das Besondere an den Modulen 2 und 3 ist, dass nur dieses mit der höheren Punktzahl in die Pflegegradermittlung einfließt. Im Modul 3 werden psychische Faktoren, wie z.B. Ängste, depressive Stimmungslagen oder Unruhezustände berücksichtigt. Dabei spielt hier die Häufigkeit des Vorkommens psychische Problemlage eine entscheidende Rolle und ob fremde Hilfe hierbei erforderlich ist.
Modul 4: Selbstversorgung
Im Modul der Selbstversorgung wird ermittelt, inwieweit die Selbstständigkeit der betreffenden Person z.B. bei der Nahrungsaufnahme, der Körperpflege, dem An- und Auskleiden oder dem Toilettengang eingeschränkt ist.
Modul 5: Selbstständiger Umgang mit und Bewältigung von therapie- oder krankheitsbedingten Belastungen und Anforderungen
In diesem Modul wird ermittelt, ob ärztliche Verordnungen, wie zum Beispiel die Medikamenteneinnahme oder das Verabreichen von Injektionen selbstständig erfolgen kann und wenn nicht, wie häufig fremde Hilfe erforderlich ist. Berücksichtigt werden u.a. auch die Wundversorgung, das An- und Ablegen von Hilfsmitteln (bspw. Kompressionsstrümpfe) oder die Hilfe bei Arzt- und Therapeutenbesuchen.
Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Im Modul 6 wird ermittelt, inwieweit die betreffende Person selbstständig ihren ihren Tagesablauf gestalten kann oder Kontakte aufrechterhalten kann.

Was ist der Unterschied zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistung?
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5, haben die Möglichkeit die Pflege, die sie benötigen, durch Freunde oder Familienmitgliedern sicherzustellen. Hierfür zahlt die Pflegeversicherung dem Pflegebedürftigen Pflegegeld, welches dann, als Anerkennung, in der Regel an die versorgenden Personen weitergegeben wird. Das Pflegegeld ist je nach Pflegegrad gestaffelt.
Können Privatpersonen die Pflege des Pflegebedürftigen nicht sicherstellen, kann auch die sogenannte Pflegesachleistung beantragt werden, damit ein Pflegedienst die Pflege zu Hause übernimmt.
Das Pflegegeld kann auch mit der Pflegesachleistung als Kombinationsleistung beantragt werden.

Was ist die Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege?
Kann die häusliche Pflege für eine begrenzte Zeit nicht oder nicht umfassend erfolgen, kann die sogenannte Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI beantragt werden. Der Pflegebedürftige bezieht für (bis zu) acht Wochen pro Kalenderjahr eine, von der Pflegekasse anerkannte, Pflegeeinrichtung. Die Kurzzeitpflege wird finanziell von der Pflegekasse unterstützt. Dabei muss bei dem Pflegebedürftigen mindestens der Pflegegrad 2 vorliegen.
Ist die private Pflegeperson, z.B. aufgrund eines Urlaubs oder einer Erkrankung verhindert die pflegebedürftige Person zu betreuen, kann die Verhinderungspflege dazu genutzt werden, diese Versorgungslücke zu schließen. Die Verhinderungspflege kann nach 6 Monaten der festgestellten Pflegebedürftigkeit zum ersten Mal beantragt werden und es muss mindestens der Pflegegrad 2 vorliegen. Die Ersatzperson kann sowohl eine zweite private Person als auch ein Pflegedienst oder eine Pflegeeinrichtung sein. Demnach kann die Verhinderungspflege auch mit der Kurzzeitpflege kombiniert werden.

Was sind wohnumfeldverbessernde Maßnahmen?
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen können von Pflegebedürftigen der Pflegegrade 1 bis 5 beantragt werden, um die häusliche Pflege im zu Hause zu erleichtern oder erst zu ermöglichen und eine selbstständige Lebensführung zu erhalten. Ziel solcher wohnumfeldverbessernder Maßnahmen ist es auch, eine Überforderung der Pflegeperson zu vermeiden. Sehr häufig werden in Deutschland beispielsweise Badumbauten beantragt - anstatt der Badewanne wird eine begehbare Dusche eingebaut - es werden Treppenlifter und Rampen benötigt oder eine Türverbreiterung ist von Nöten.
Erforderlich ist, dass die Kostenübernahme der entsprechenden Maßnahmen vor Beginn der Umbaumaßnahmen von der Pflegekasse genehmigt werden.
Ein Zuschuss zur Wohnungsanpassung kann auch ein zweites Mal gewährt werden, wenn die Pflegesituation sich derart verändert hat, dass erneute wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nötig werden.

Wie bekommt man ein Pflegehilfsmittel?
Pflegehilfsmittel werden nach technischen Pflegehilfsmitteln und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel. Unter technischen Pflegehilfsmitteln fallen zum Beispiel Pflegebetten, Badewannenlifter, Gehhilfen oder Notrufsysteme. Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel sind u.a. Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder saugende Bettschutzeinlagen für den Einmalgebrauch.
Voraussetzung für den Erhalt von Pflegehilfsmitteln ist das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 1 bis 5) und ein formloser Antrag bei der Pflegekasse.
©Copyright. Alle Rechte vorbehalten.